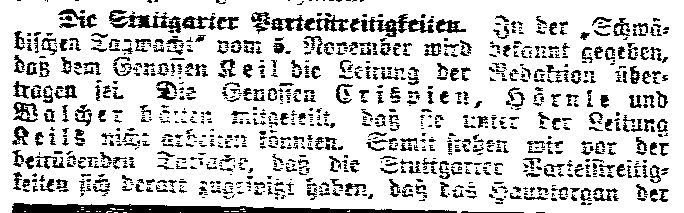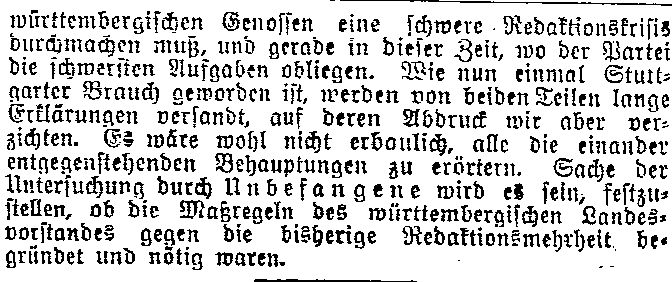SPD-Reichstagsfraktion debattiert über Kriegsziele und Frieden

Marschierende Soldaten. Während immer mehr Männer in den Krieg ziehen, plant die Regierung neue Ausgaben. Quelle: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 6/FOTB000774.
Am 29. und 30. November 1914 kam es in zwei Fraktionssitzungen zu Auseinandersetzungen über die neuen Kriegskredite. Neben den schon im Fraktionsvorstand angesprochenen Bedingungen wurde die generelle Kritik am Ablauf des Kriegs lauter. Während die Mehrheit der Sozialdemokraten weiterhin dem Glauben anhing, einen Verteidigungskrieg gegen das zaristische Russland zu führen, trat nun die Frage, welche Kriegsziele im Westen verfolgt würden, immer deutlicher zutage. Karl Liebknecht hielt eine lange Rede gegen den von »deutschen Imperialisten inszenierten Eroberungskrieg« und forderte dessen sofortiges Ende. Selbst der dem rechten Parteiflügel zuzurechnende Eduard Bernstein hegte nach der Lektüre englischer Zeitungsveröffentlichungen inzwischen Zweifel an der Legende des Verteidigungskriegs.[1] Hugo Haase brachte weiterhin Bedingungen ein, die im Gegenzug zu einer erneuten Bewilligung zu stellen wären. Insbesondere sollten jegliche Annexionen ausgeschlossen und der Bruch der belgischen Neutralität offiziell bedauert werden. Zudem müsste die im Reichstag abgegebene Erklärung die Forderung nach einem raschen Frieden beinhalten. Gegen solche Verlautbarungen sprachen sich unter anderem Philipp Scheidemann und Gustav Noske aus.[2] Zur Zufriedenheit des reformistischen Parteiflügels wurden die Vorschläge von der Mehrheit der Fraktion abgelehnt. Eduard David notierte:
»Mir fallen zwei schwere Steine vom Herzen. Die Erklärung wäre gründlich versaut gewesen. Der Friedenspassus wäre als ein höchst bedenkliches Schwäche-Eingeständnis, als Bitte um Frieden und Gnade ausgelegt worden. Der belgische Passus wäre ein skandalöser Stoß in den Rücken des eigenen Volkes gewesen.«[3]
Die meisten sozialdemokratischen Politiker hielten an der Hoffnung, durch eine Beteiligung am Krieg eine stärkere Position in der Zeit danach zu haben, fest. Man kämpfte primär nicht gegen Engländer und Franzosen, sondern gegen den englischen und französischen Kapitalismus. Hermann Molkenbuhr skizzierte solche Überlegungen am 30. November in seinen Tagebuchaufzeichnungen:
»Das Deutsche Reich ist das Land, welches die Arbeiter nach ihrem Sinn umformen wollen. Sie wollen Besitz ergreifen von dem Reiche. Da haben sie ein Interesse, es nicht zerschlagen zu lassen. Deutschlands Unabhängigkeit zu erhalten, das wird mit Hilfe der Arbeiter gelingen. Aber nach dem Frieden muß mit der bisherigen Politik gründlich gebrochen werden. Gelingt es Deutschland zu sozialisieren – das einzige Mittel, die Wunden des Krieges schnell zu heilen –, dann wird der soziale Gedanke überspringen nach Frankreich und England und hierdurch die Basis für die Interessenverschmelzung der Völker von Westeuropa gefunden.«[4]
[1] Vgl. Eintrag zum 7. November 1914, in: Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 1914 bis 1918, bearb. v. Susanne Miller (= Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Erste Reihe: Von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen Republik, hrsg. v. Werner Conze u. Erich Matthias, Bd. 4), Düsseldorf 1966, S. 65.
[2] Vgl. insgesamt die Einträge zum 29. und 30. November 1914, in: ebd., S. 73f.
[3] Ebd., S. 74.
[4] Bernd Braun/Joachim Eichler (Hrsg.), Arbeiterführer – Parlamentarier – Parteiveteran. Die Tagebücher des Sozialdemokraten Hermann Molkenbuhr 1905 bis 1927, München 2000, S. 235.