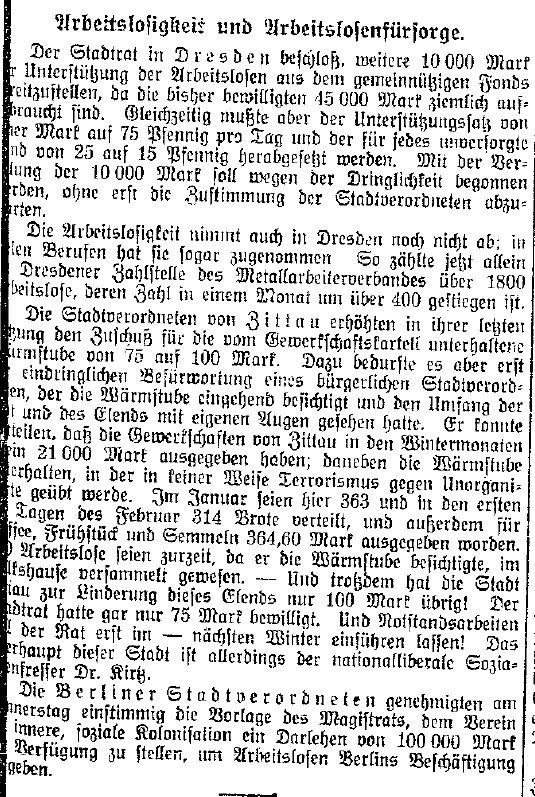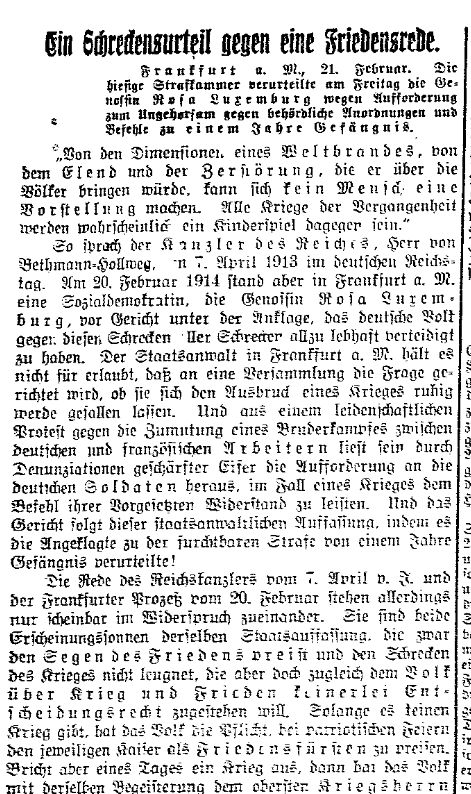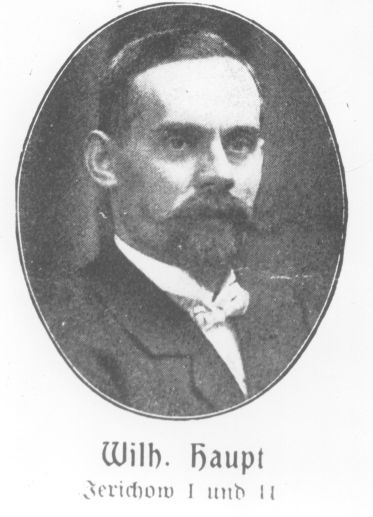Große regionale Unterschiede in der Arbeitslosenfürsorge
Trotz der wirtschaftlichen Hochkonjunktur der letzten beiden Jahrzehnte im Deutschen Reich und einer relativ geringen Arbeitslosenquote im geschätzten Bereich von 2–3% vor dem Ersten Weltkrieg (eine offizielle Quote wurde erst ab 1927 errechnet)[1], blieb der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ein Kernthema der Arbeiterbewegung. Wer das Pech hatte, seine Anstellung zu verlieren, war existenziell gefährdet. Die teilweise durch die Gemeinden geleistete Arbeitslosenversorgung mit Nahrungsmitteln reichte oft nicht zum Leben aus. Wie die »Volkswacht« an den Beispielen Dresden, Berlin und Zittau verdeutlichte, gab es zudem große regionale Unterschiede. Eine staatlich geregelte Arbeitslosenversicherung wurde zwar im Reichstag diskutiert[2], jedoch erst zur Zeit der Weimarer Republik 1927 eingeführt. Eine Möglichkeit zur sozialen Absicherung boten Unterstützungskassen für gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter an. Um vor dem Schicksal der Arbeitslosigkeit zu warnen, wurde das Thema in der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Presse oft aufgegriffen.
Link zur Quelle: »Volkswacht« (Westpreußen) vom 25. Februar 1914.
[2] Vgl. dazu: Edmund Fischer, Arbeitslosigkeit und Arbeitsscheu, in: Sozialistische Monatshefte, 1914, H. 4, S. 223–227. Die dortige Sicht auf ›Arbeitsscheue und Vagabunden‹ als geistig Kranke sollte als klare Abgrenzung zu arbeitswilligen Arbeitslosen dienen. Edmund Fischer, SPD-MdR für Zittau, war vor seiner Tätigkeit als Redakteur und Politiker als Holzbildhauer auf Wanderschaft gewesen.